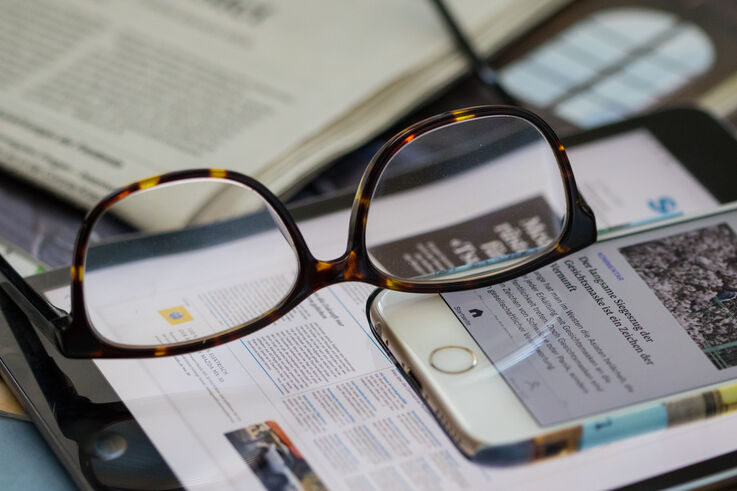Medienschau Januar 2025
Die Medienschau von palliative zh+sh gibt Einblick in die Berichterstattung zu Palliative Care und verwandten Themen des vergangenen Monats. (Bild gme)
Portrait
Weitere Infos zum Thema
Links zum Thema
Dokumente zum Thema
04. Februar 2025
/
Medien
In Genf soll dank «Palli-GeMed» die ambulante Palliativversorgung gestärkt werden, die Geschäftsführerin von palliative.ch zieht Bilanz ihrer Amtszeit und Mona Vetsch verbringt drei Tage im Hospiz St. Gallen. Diese und weitere Themen in unserer Medienschau vom Januar.
Mit der Einführung von «Palli-GeMed» haben die Universitätskliniken Genf (HUG) und die mobilen Ärzte «Genève Médecins» eine Partnerschaft ins Leben gerufen, um die Palliativversorgung bei akuten häuslichen Notfällen zu stärken. Die neue Struktur bietet Menschen mit lebensbedrohlichen Erkrankungen und ihren Angehörigen Unterstützung direkt zu Hause – insbesondere bei akuten Symptomen wie Schmerzen oder Atemnot. «Ein palliativer Notfall kann beispielsweise auftreten, wenn ein Patient mit einer fortgeschrittenen Erkrankung zu Hause bleiben möchte, aber ein akutes Problem hat, das eine schnelle Intervention erfordert», erklärt Simon Singovski, Leiter der Sprechstunde für häusliche Palliativmedizin. Ziel sei es, durch gezielte Eingriffe eine schnelle Linderung zu erreichen und Spital-Aufenthalte zu vermeiden. Bisher waren Patienten in solchen Situationen häufig gezwungen, den Notruf 144 zu wählen und in die Notaufnahme überwiesen zu werden. Mit «Palli-GeMed» steht nun ein speziell geschultes Team bereit, das dringende Erste Hilfe direkt vor Ort leisten kann. Dabei wird nicht nur die Akutversorgung sichergestellt, sondern auch eine nahtlose Übergabe an das bestehende Pflegenetzwerk gewährleistet.
«Palli-GeMed soll Genfer Palliativversorgung stärken». medinside. 9.1.2025
***
Renate Gurtner Vontobel, die abtretende Geschäftsführerin von palliative.ch, hat mit «medinside» über Erlebnisse und Erfahrungen ihrer fünfeinhalbjährigen Amtszeit gesprochen. Unter anderem sagte sie: «Die Tendenz der Ambulantisierung betrifft auch die Palliative Care. Es braucht eine gute ambulante palliativmedizinische Begleitung und parallel dazu braucht es mehr Betten in Hospizen.» Die Spitex müsse spezialisierte Teams für Palliative Care bilden.
«Viele Spitex-Organisationen haben das bereits gemacht, zum Teil mit medizinischen Fachpersonen, zum Teil ohne. Diese Teams arbeiten dann mit Zentrumsärzten oder mit spezialisierten Hausärztinnen und Hausärzten zusammen.» Das Angebot an Spezialisierter ambulanter Palliative Care sei aber von Kanton zu Kanton verschieden. «Die Romandie ist breiter und besser aufgestellt als die Deutschschweiz. Sie hat auch eine längere Tradition», sagt Renate Gurtner Vontobel. Gut aufgestellt sei auch Zürich. Bern habe jetzt aufgestockt und auch Basel habe ein Team. Anderswo gäbe es aber noch beträchtliche Lücken. «Es steht und fällt mit der Finanzierung», sagt die abtretende Geschäftsführerin. «Wir sprechen hier von so genannten Beratungsleistungen, die in der zweiten Linie passieren. Die Spezialteams beraten die Pflegefachkräfte der Spitex oder die Hausärztinnen, die selber tarifarisch abrechnen. Doch für diese Zweitlinienleistungen - es ist wie mit dem Back-office - gibts bis heute noch keine Tarife.»
Im ausführlichen Interview von «medinside» spricht Renate Gurtner Vontobel auch über die Motion «für eine angemessene Finanzierung der Palliative Care», über die Klärung der Leistungsvergütungen für Hospize und zieht eine Bilanz über ihre fünfeinhalb Jahre als Geschäftsführerin von palliative.ch. Ende Januar ist Renate Gurtner Vontobel in Pension gegangen. Ihre Nachfolgerin ist Corina Wirth. Die studierte Physikerin hat in Neurophysiologie promoviert. Bis Ende 2024 war sie Geschäftsführerin des nationalen Fachverbandes Public Health Schweiz.
«Wir brauchen nicht mehr Betten in Spitälern, aber in Hospizen». medinside. 23.1.2025
«Palli-GeMed soll Genfer Palliativversorgung stärken». medinside. 9.1.2025
***
Renate Gurtner Vontobel, die abtretende Geschäftsführerin von palliative.ch, hat mit «medinside» über Erlebnisse und Erfahrungen ihrer fünfeinhalbjährigen Amtszeit gesprochen. Unter anderem sagte sie: «Die Tendenz der Ambulantisierung betrifft auch die Palliative Care. Es braucht eine gute ambulante palliativmedizinische Begleitung und parallel dazu braucht es mehr Betten in Hospizen.» Die Spitex müsse spezialisierte Teams für Palliative Care bilden.
«Viele Spitex-Organisationen haben das bereits gemacht, zum Teil mit medizinischen Fachpersonen, zum Teil ohne. Diese Teams arbeiten dann mit Zentrumsärzten oder mit spezialisierten Hausärztinnen und Hausärzten zusammen.» Das Angebot an Spezialisierter ambulanter Palliative Care sei aber von Kanton zu Kanton verschieden. «Die Romandie ist breiter und besser aufgestellt als die Deutschschweiz. Sie hat auch eine längere Tradition», sagt Renate Gurtner Vontobel. Gut aufgestellt sei auch Zürich. Bern habe jetzt aufgestockt und auch Basel habe ein Team. Anderswo gäbe es aber noch beträchtliche Lücken. «Es steht und fällt mit der Finanzierung», sagt die abtretende Geschäftsführerin. «Wir sprechen hier von so genannten Beratungsleistungen, die in der zweiten Linie passieren. Die Spezialteams beraten die Pflegefachkräfte der Spitex oder die Hausärztinnen, die selber tarifarisch abrechnen. Doch für diese Zweitlinienleistungen - es ist wie mit dem Back-office - gibts bis heute noch keine Tarife.»
Im ausführlichen Interview von «medinside» spricht Renate Gurtner Vontobel auch über die Motion «für eine angemessene Finanzierung der Palliative Care», über die Klärung der Leistungsvergütungen für Hospize und zieht eine Bilanz über ihre fünfeinhalb Jahre als Geschäftsführerin von palliative.ch. Ende Januar ist Renate Gurtner Vontobel in Pension gegangen. Ihre Nachfolgerin ist Corina Wirth. Die studierte Physikerin hat in Neurophysiologie promoviert. Bis Ende 2024 war sie Geschäftsführerin des nationalen Fachverbandes Public Health Schweiz.
«Wir brauchen nicht mehr Betten in Spitälern, aber in Hospizen». medinside. 23.1.2025
SRF-Journalistin Mona Vetsch besucht für die Reportagereihe «Mona mittendrin» für drei Tage das Hospiz in Sankt Gallen und kommt dabei an ihre Grenzen. Sie begleitet in der Villa Jacob die Pflegerinnen und trifft dabei auf Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt. Zum Beispiel auf die ehemalige Sportlehrerin Heidi und den schwerkranken Informatiker Nicolas. «Ich kann gehen, ich bin im Frieden», sagt die 67 Jahre alte Heidi zu Mona. Die Worte sind klar, die Stimme und der Körper aber schwach. Der Krebs hat die Lebensenergie vertrieben. Sie ist unheilbar krank und weiss, dass sie bald sterben wird. Noch bis vor kurzem ist sie als Clownin aufgetreten und hat, als ehemalige Sportlehrerin, eine Bewegungsgruppe für Seniorinnen und Senioren geleitet. «Noch vor ein paar Wochen war ich im Spital und hatte das Gefühl, ich könnte einfach die nächste Therapie starten. Aber dann sagt dir der Arzt: Stopp, es bringt nichts mehr», sagt Heidi zur sichtlich betroffenen Reporterin. In einem Zimmer nebenan liegt der 45-jährige Nicolas. «Ich weiss nicht, ob das schon das Tal ist. Sie scheint immer wieder etwas Neues in petto zu haben, diese Krankheit», sagt der Informatiker. Mit viel Empathie begegnet Mona den Patientinnen und Patienten, begleitet die Pflegefachpersonen bei ihrer Arbeit, kommt mit Raoul Pinter, dem Leitenden Arzt des Palliative Care Hospiz St. Gallen, ins Gespräch. Wer diese Ausgabe von «Mona mittendrin» bisher nicht geschaut hat, dem sei die informative, realitätsnahe und einfühlsam produzierte TV-Sendung empfohlen. Und Monas Fazit nach dem dreitägigen Besuch? «Die Begegnungen haben mir bewusst gemacht, wie wertvoll das Leben ist.»
«Mona mittendrin – Abschied im Hospiz». SRF. 15.1.2025
***
Der Countdown zum diesjährigen Award des Gesundheitswesens. Nun können Sie Ihre Stimme abgeben. Wer soll besonders gewürdigt werden im Schweizer Gesundheitswesen? Wer hat in letzter Zeit eine grandiose Leistung vollbracht? Beim Viktor, dem grossen Preis des Schweizer Gesundheitswesens, stehen diesmal fünf Kategorien zur Auswahl. Zu den Nominierten in der Kategorie “Herausragende Persönlichkeit” gehört Renate Gurtner, Geschäftsführerin palliative.ch (bis Ende Januar 25): "Sie hat der Palliative Care mit palliative.ch eine Stimme gegeben. Eine Macherin mit grossem Engagement”, heisst es in der Ausschreibung. Der Award wird am 20. März 2025 bei einem Galaabend im Kursaal Bern verliehen. Zu 50 Prozent bestimmt die Jury, wer dann auf dem Siegertreppchen stehen wird. Die Stimmen des Publikums zählen ebenfalls zur Hälfte. Hier können Sie Ihre Stimme abgeben: viktor-award.ch/

“Viktor 2024: Reden Sie mit, stimmen Sie ab!” medinside.ch. 28.01.2025
Wie erträgt ein Mensch den Verlust des eigenen Kinds? Was hilft beim Trauern? Ist Trauer endlos? Der deutsche Autor Berni Mayer ist selbst betroffen und hat zu diesen Fragen ein Buch geschrieben: «Das vorläufige Ende der Zeit» heisst sein neuster Roman. 2007 kam sein erster Sohn Vincent zwei Wochen vor dem errechneten Termin tot zur Welt. 2016 wurde bei der knapp zweijährigen Tochter Olivia ein Hirntumor diagnostiziert, 2019 starb Olivia an ihrer Krebserkrankung. «Kann man so etwas überhaupt verarbeiten?», fragt die «Schweiz am Wochenende» im Interview den 50-Jährigen. «Ärzte sagen oft, es sei ein Wunder, wie resilient Eltern sind, wenn es ihren Kindern schlecht geht. Wie sie durchhalten und funktionieren trotz all dem Leid. Das ist wohl ein Automatismus, den die Natur so eingerichtet hat», sagt Berni Mayer. In einem früher erschienen Buch «Anleitung zum Traurig sein» schreibt er davon, dass man heute zur Auffassung gelangt sei, Trauer gar nicht überwinden zu müssen. «Trauer geht nicht vorbei, deshalb geht es darum, sie in den Alltag zu integrieren. Trauern läuft parallel ab, zum Alltag und auch zu glücklichen Momenten. Es passiert vieles gleichzeitig.» Er persönlich habe schlicht versucht, sich über Wasser zu halten, mit Sport, Meditation, auch mit Medikamenten. Heilt Zeit Wunden? Kann Trauer zum guten Gefährten werden? «Es gibt ein wundervolles Kinderbuch, «Gebrauchsanweisung gegen Traurigkeit», sagt Berni Mayer. «Hier wird ein blaues Wesen zum Freund, dieses Wesen ist die Traurigkeit. Ich finde auch die Philosophie des Buddhismus hilfreich, das Annehmen, das nicht Hadern mit den Dingen.» Der Gedanke aber, Verstorbene loslassen zu müssen, bezeichnet der Autor als überholt. «Natürlich sollte es auch keine Überfixierung geben. Vielleicht hilft es, der Linearität von Zeit nicht so viel Bedeutung beizumessen. Sondern Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als gleichwertig zu betrachten. Das tröstet. Es ist ganz normal, dass ein verstorbener Mensch in den Gedanken und Erinnerungen bleibt.»
«Wir Trauernden brauchen euch». Schweiz am Wochenende. 25.1.2025
***
«Die Erinnerung an Carlos Lachen und seine gute Laune zaubert nicht nur mir ein Lächeln aufs Gesicht», sagt Dania Kobler aus Bad Ragaz (53). Sie ist mit ihrem Hund Curly unterwegs und der Journalistin von «Schweiz am Wochenende». Curly tanzt. Vor Freude. «Komm her, Curly. Jetzt nicht», sagt sie liebevoll und nimmt den Hund auf den Schoss. Dann erzählt Dania Kobler vom kurzen Leben ihres Sohnes Carlo, seiner Krankheit und seinem Tod. «Carlo war erst elf Jahre alt, als er in meinen Armen starb», sagt sie leise und verstummt für einen Moment. Sie atmet tief durch. Beim Erzählen wird ihre Stimme etwas sicherer, und ein kurzes Lächeln überspielt ihren Schmerz: «Carlo war mein viertes Kind.» Als Carlo sieben Monate alt war, erhielten sie die niederschmetternde Diagnose. Glutarazidurie Typ 1. Die Spezialisten sagten den Koblers, Carlo werde nie laufen, nie sprechen, nie selbstständig sein können. Die Diagnose der seltenen Stoffwechselkrankheit erschütterte die ganze Familie. «Wir mussten unser Leben umstellen und einen Weg finden, wie wir von nun an als Familie funktionieren können», erklärt Kobler. Irgendwie musste es ja weitergehen. Die Tage wurden durchgetaktet. Doch Carlo sei nie eine Last gewesen. Ihn in ein Heim zu geben, wäre zu der Zeit nicht infrage gekommen. Die Familie habe versucht, den Alltag so normal wie möglich zu gestalten. Carlo sei aufgrund seiner Krankheit sehr harmoniebedürftig gewesen. Gerade wenn es in der Familie einmal Streit gegeben hätte, sei das für Carlo schwer zu ertragen gewesen. «Carlo hat uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt», sagt die Mutter. Die Herausforderung für die Familie sei enorm gewesen. Es habe auch an ihren Kräften gezerrt.
Manchmal wünscht sich Carlos Mutter, jemand hätte ihr viel früher gesagt, wie wichtig es ist, psychologische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Denn nach dem Tod von Carlo mussten sich alle neu finden. «Jeder trauert anders, und doch gehören alle zusammen», sagt Kobler. Heute engagiert sie sich am Kinderspital Zürich im interprofessionellen Team der Palliative Care.
«Carlo fragte: «Wie ist das mit dem Sterben?». Schweiz am Wochenende. 25.1.2025
Es gibt kaum grausamere Schicksale, als wenn ein Elternteil viel zu früh aus dem Leben scheidet und seine Kinder nicht mehr aufwachsen sieht. Genau mit solchen Schicksalsschlägen setzt sich Gabriela Meissner auseinander. Nachdem sie viele Jahre im Journalismus und in der Kommunikation gearbeitet hatte, wechselte sie zu palliative zh+sh. «Schon als Journalistin fiel es mir relativ leicht, über schwierige Themen und insbesondere den Tod zu sprechen und zu schreiben», erinnert sich die 58-jährige Urdorferin. Das habe überhaupt nichts mit morbider Faszination zu tun. «Der Tod gehört nun einfach mal zum Leben. Irgendwann werden wir alle mit ihm konfrontiert.» Schlimmstenfalls viel zu früh. Nämlich dann, wenn junge Eltern an einer unheilbaren Krankheit leiden. Damit sich die Kinder auch weit über den Tod ihres Elternteils an ihre Mutter oder ihren Vater erinnern können, produziert Meissner zusammen mit weiteren Audiobiografinnen sogenannte Hörschätze – Audioaufnahmen des Elternteils, das bald sterben wird. In den letzten vier Jahren haben Gabriela Meissner und ihr Team über 90 Hörschätze geschaffen. Doch wie muss man sich diese Begegnungen mit einem todgeweihten Elternteil vorstellen, der weiss, dass er bald sterben wird und seine Kinder nicht aufwachsen sieht? «Das sind in aller Regel sehr intime und emotionale Begegnungen.» Natürlich erlebe sie immer wieder Momente grosser Trauer und auch Wut. Dann etwa, wenn eine krebskranke Mutter sich fragt, wo da die Gerechtigkeit bleibt, oder einen jungen Vater das schlechte Gewissen plagt, weil es sich für ihn so anfühlt, als würde er seine Kinder im Stich lassen. Aber, so Meissner weiter, man würde gar nicht glauben, wie viel Platz es bei diesen Gesprächen auch für positive, dankbare Gefühle habe. «Auch wenn die Betroffenen zu früh gehen müssen, blicken die meisten auf ein erfülltes Leben zurück.» Dabei könne diese Art von Biografiearbeit am Lebensende durchaus eine Art therapeutische Wirkung entfalten.
«Die Eltern sterben, ihre Stimmen bleiben». Schweiz am Wochenende. 4.1.2025
palliative zh+sh / Bettina Weissenbrunner